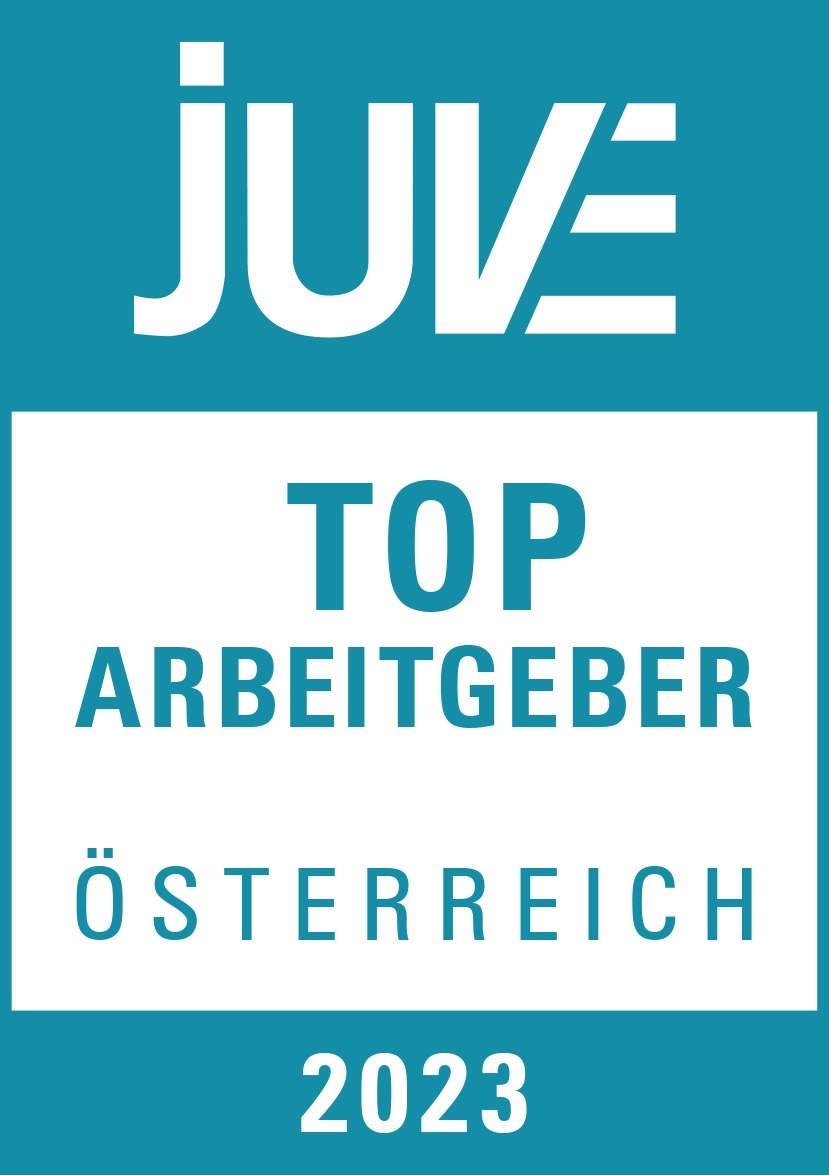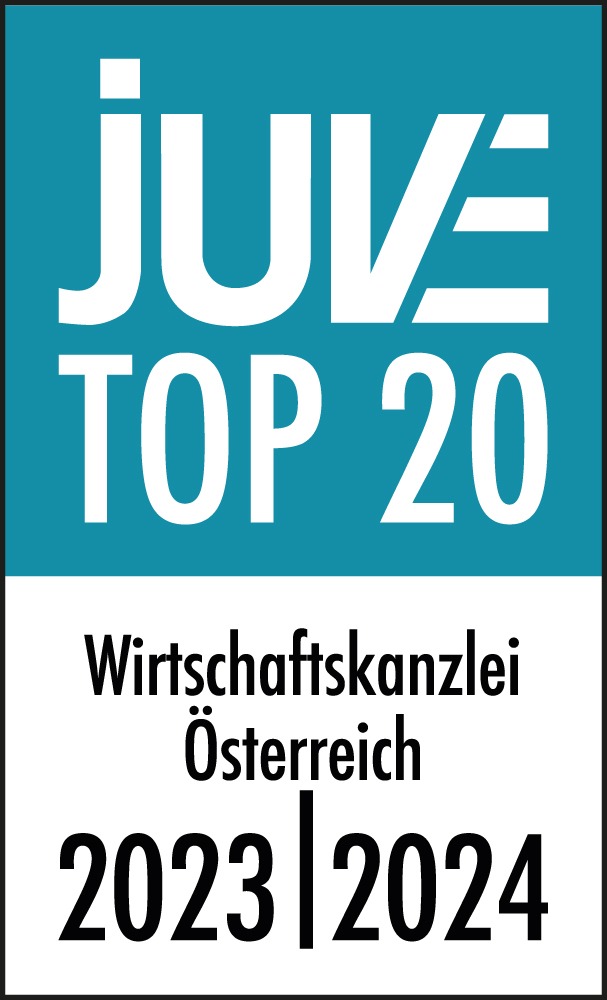Online-Vermittlungsdienste spielen ebenso wie Suchmaschinen eine besonders bedeutsame Rolle in der Netzökonomie. In zahlreichen Sparten haben sich einzelne Unternehmen als dominante Anbieter herausgebildet, die ihre erlangte Marktmacht mitunter zum Missfallen von Nutzern und Regulatoren ausüben. Eine neue EU-Verordnung setzt sich deshalb das ambitionierte Ziel, Fairness und Transparenz bei Online-Plattformen im B2B-Bereich zu fördern – mit Auswirkungen auch für Verbraucher.
Hintergrund
Die Förderung gerade auch des digitalen Binnenmarkts war eines der zentralen Ziele der scheidenden Juncker-Kommission. Sie sollte durch ein Bündel an exekutiven und legislativen Maßnahmen erfolgen. Zu Ersteren zählte etwa eine umfangreiche Sektoruntersuchung der Europäischen Kommission zum elektronischen Handel, zu Letzteren beispielsweise eine Verordnung über „ungerechtfertigtes Geoblocking“ – und jüngst eben auch der Entwurf einer Verordnung zur Förderung der Fairness und Transparenz bei Online-Plattformen im B2B-Bereich.
Hintergrund des Verordnungsvorschlags, über den das EU-Parlament und der Ministerrat kürzlich eine Einigung erzielten, ist die zentrale Bedeutung und Marktmacht von Vermittlungsdiensten im Bereich der Internet-Ökonomie. Oft sind es solche Dienste, die einen grenzüberschreitenden Zugang zu Absatzmärkten, insbesondere für KMUs, erst ermöglichen. Gleichzeitig wird ein Großteil der online gesammelten Daten über Suchmaschinen und Online-Plattformen generiert.
Anwendungsbereich
Die vorgeschlagene Verordnung soll für Online-Vermittlungsdienste und Online-Suchmaschinen gelten, und zwar unabhängig davon, wo deren Betreiber ihren Sitz oder ihre Niederlassung haben, sofern sie (i) ihre Leistungen gewerblichen Nutzern oder Nutzern mit Unternehmenswebsite anbieten, die (ii) (Wohn-)Sitz oder Niederlassung in der EU haben und ihre Leistungen über diese Dienste Verbrauchern in der EU anbieten.
Beispiele für Online-Vermittlungsdienste, die vom Anwendungsbereich der Verordnung erfasst wären, sind etwa Online-Marktplätze wie Amazon Marketplace, Online-Dienste sozialer Medien für gewerbliche Nutzer wie Facebook Pages, Vertriebsplattformen für Softwareanwendungen, worunter insbesondere App-Stores wie Google Play oder der Apple App Store fallen, oder auch Preisvergleichsdienste. Nicht erfasst sind etwa sogenannte Peer-to-Peer („P2P“) Online-Vermittlungsdienste ohne Beteiligung gewerblicher Nutzer, reine Business-to-Business („B2B“) Online-Vermittlungsdienste, die nicht Verbrauchern angeboten werden, oder Online-Zahlungsdienste.
Der Begriff der Online-Suchmaschine soll technologieneutral verstanden werden, um dem hohen Innovationstempo gerecht zu werden, und insbesondere auch Suchen aufgrund von Spracheingaben erfassen.
Die neuen Vorschriften haben nicht zum Ziel, andere rechtliche Rahmenbedingungen, wie etwa lauterkeits- und wettbewerbsrechtliche Regelungen, zu verdrängen. In der Tat sind Plattformbetreiber und Plattformmärkte zuletzt intensiv in den Fokus von Wettbewerbsbehörden geraten, wie etwa die Verfahren der Europäischen Kommission gegen Google, jenes des deutschen Bundeskartellamts gegen Facebook oder die aktuellen Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde und des Bundekartellamts gegen Amazon verdeutlichen. Jene Vorschriften bleiben weiterhin anwendbar, allerdings soll die Verordnung gewissen als „Missstand“ empfundenen Situationen – etwa im Zusammenhang mit der Reihung von Suchergebnissen, die überraschende Beendigung von Geschäftsbeziehungen oder besonders benachteiligende Konfliktlösungsmechanismen – durch umfassende Transparenzvorschriften vorbeugen.
Wesentliche Inhalte
Die Verordnung sieht für Betreiber von Online-Vermittlungsdiensten oder Suchmaschinen nun zahlreiche, durchaus detaillierte und teils auch überlappende Verpflichtungen vor:
- Anforderungen an Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): AGB sollen zuvorderst klar und verständlich formuliert sein. Sind sie unbestimmt, ungenau oder in wichtigen Punkten nicht ausreichend ausführlich, um die gewünschten Rechtsfolgen erkennen zu lassen, genügen Sie den Anforderungen der Verordnung nicht, was ihre Nichtigkeit zur Folge hat. Will ein Betreiber eines Online-Vermittlungsdienstes sich die Möglichkeit vorbehalten, seine Dienste für gewerbliche Nutzer auszusetzen oder einzuschränken, sind die Gründe hierfür in den AGB klar auszuweisen. Sollen die AGB während der Laufzeit geändert werden, so sind die Vertragspartner darüber mit angemessener, mindestens 15-tägiger Vorlaufzeit zu unterrichten. Wollen sie sich den geänderten AGB nicht unterwerfen, soll es den gewerblichen Nutzern freistehen, den Vertrag zu kündigen. Damit einher geht das Verbot rückwirkender Änderungen der AGB.
- Einschränkung, Aussetzung oder Beendigung der Dienste: Einer der Gründe für die wettbewerbsrechtlichen Ermittlungen gegen Amazon besteht in der angeblich plötzlichen und unbegründeten Sperre von Händlerkonten. In Hinkunft soll stets dann, wenn ein Online-Vermittlungsdienst seine Dienste einzuschränken oder auszusetzen gedenkt, der gewerbliche Nutzer spätestens mit dem Wirksamwerden der Sperre eine Begründung erhalten; im Falle einer vollständigen Beendigung hat die Information zumindest 30 Tage vor Wirksamwerden der Beendigung zu erfolgen.
- Rankings: Um Rankings transparenter zu gestalten, sollen die wichtigsten Parameter und die Gründe ihrer relativen Gewichtung offengelegt werden; eine Bekanntgabe der Algorithmen wird allerdings nicht gefordert.
- Nebenwaren- und Dienstleistungen: Oftmals werden auf Plattformen zu den Hauptleistungen der gewerblichen Nutzer vom Plattformbetreiber oder Dritten Nebenwaren und -dienstleistungen (darunter auch Finanzprodukte) angeboten, wie etwa Versicherungen bei Buchung eines Mietwagens oder einer Reise. Die Verordnung sieht vor, dass der Online-Vermittlungsdienst in seinen AGB die Art der angebotenen Nebenwaren und -dienstleistungen zu beschreiben hat sowie auch, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen der gewerbliche Nutzer berechtigt ist, eigene Nebenwaren und -dienstleistungen anzubieten.
- Differenzierte Behandlung von (eigenen) Waren und Dienstleistungen: Oftmals bieten Betreiber von Online-Vermittlungsdiensten oder Online-Suchmaschinen Verbrauchern gegenüber auch eigene Waren oder Dienstleistungen an, die dann im Wettbewerb zu den Produkten und Leistungen der gewerblichen Nutzer der Plattform stehen. Da die Plattformbetreiber die Plattform kontrollieren, könnte ein Anreiz bestehen, eigenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber jenen der übrigen gewerblichen Nutzer technische oder wirtschaftliche Vorteile einzuräumen. Ist dies beabsichtigt, so ist dies transparent darzulegen. Ein Verbot der „Selbstbevorzugung“ oder – positiv formuliert – ein Gebot zur Gleichbehandlung enthält die Verordnung jedoch nicht.
- Zugang zu Daten: Betreiber von Online-Vermittlungsdiensten sind in der Position, einen Wert aus jenen Daten zu schöpfen, die durch die Tätigkeit der gewerblichen Nutzer auf der betreffenden Plattform generiert werden. Um die gewerblichen Nutzer in die Position zu versetzen, zu verstehen, ob der betreffende Betreiber von Online-Vermittlungsdiensten Daten selbst verarbeitet oder Dritten diese Daten zur Verfügung stellt, soll über die Bedingungen, Umfang und die Art des Zugriffs auf jene Daten aufgeklärt werden.
- Meistbegünstigungsklauseln: Möchte der Betreiber eines Online-Vermittlungsdienstes Meistbegünstigungsklauseln vorsehen, so hat er die wichtigsten wirtschaftlichen, geschäftlichen oder rechtlichen Gründe hierfür zu erläutern. In diesem Zusammenhang hält die Verordnung ausdrücklich fest, dass mit dieser Offenlegungsverpflichtung die Rechtmäßigkeitsprüfung nach anderen Vorschriften nicht berührt werden soll. Für Österreich ist daran zu erinnern, dass der Gesetzgeber Meistbegünstigungsklauseln durch Betreiber von Buchungsplattformen gegenüber Beherbergungsunternehmen als „unter allen Umständen unlautere Geschäftspraktik“ im UWG festgeschrieben und damit verboten hat.
- Konfliktlösung: Neben den zahlreichen Offenlegungs- und Transparenzvorschriften verpflichtet die Verordnung Betreiber von Online-Vermittlungsdiensten auch zur Einrichtung eines Beschwerdemanagementsystems sowie zur Bekanntgabe von zwei oder mehr Mediatoren, mit denen sie bereit sind zusammenzuarbeiten, um einen allfälligen Streitfall mit gewerblichen Nutzern zu lösen. Die hierdurch eröffnete Möglichkeit zur Mediation soll gewerbliche Nutzer aber nicht daran hindern, direkt ein Gericht anzurufen. Zum Teil neu ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit gewerblicher Nutzer, sich in solchen Streitigkeiten von Verbänden vertreten zu lassen (in Österreich besteht diese Möglichkeit bei manchen Verfahrensarten bereits jetzt).
Ausblick
Die Verordnung wird ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU wirksam. Sie ist dann in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar. Es steht den Mitgliedsstaaten jedoch weiterhin frei, einseitige Verhaltensweisen oder unlautere Geschäftspraktiken zu verbieten oder zu ahnden, sofern die betreffenden nationalen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem übrigen Unionsrecht angewandt werden. In einer gemeinsamen Erklärung stellten Deutschland und Österreich klar, dass sie davon ausgingen, dass Mitgliedsstaaten insbesondere weitergehende Regelungen zur Sicherung der Medienvielfalt erlassen dürften – ein möglicher Hinweis auf anstehende nationale Gesetzesvorhaben.
Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie bei unserem Team Kartell- und Beihilfenrecht.
18. Juni 2019
Zurück zur Übersicht